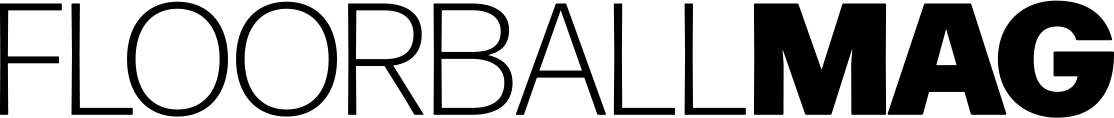Als vor ein paar Wochen die Prague Open stattfanden, reiste nur eine Juniorinnen-Auswahl und eine einzige Junioren-Mannschaft nach Tschechien. Auch andere Sommerturniere werden von deutschen Nachwuchs-Teams kaum aufgesucht. So wird das nix. Hat hier denn niemand Bock zu zocken?
Sportunterricht gekapert
Ich entdeckte Floorball irgendwann Ende des vergangenen Jahrhunderts. Vielleicht war ich elf oder zwölf Jahre alt. Ich besuchte damals die Deutschen Schule in Prag, wo man dieses „Plastikhockey“ noch eher sporadisch spielte. Erst nach meinem Wechsel ans Österreichische Gymnasium in Prag nahmen die Dinge Fahrt auf. Eher zufällig traf ich dort auf eine Gruppe Gleichgesinnter, die sich nebenbei auch noch als brauchbare Freunde fürs Leben erwiesen.
Die Sache eskalierte früh. Unser Sportlehrer war für unsere einheitliche Begeisterung derart dankbar, dass er uns den Sportunterricht für die darauffolgenden fünf Jahre kapern ließ. Wir gründeten eine schulinterne Floorball-Liga, nahmen an einer weiteren für Prager Schulen teil und gründeten später sogar einen eigenen Verein. Der Kern unserer Truppe spielte dort in der ersten und zweiten Herren-Mannschaft und wenn es sich einrichten ließ auch im Junioren-Team. Hatte es doch ein Wochenende gegeben, an dem kein Spielbetrieb angesetzt war, mieteten wir eine Turnhalle an, stellten zwei Schwedenkästen auf und zockten bis uns die Hände brannten.
In den intensivsten Jahren, vielleicht im Alter zwischen fünfzehn und achtzehn, bekamen wir gut 40 Spiele pro Saison aufs Parkett. Ich kann mich nicht entsinnen, dass in jener Zeit irgendeiner aus unserer Truppe wegen Krankheit ausgefallen wäre. Und wer sich zu einem Pflichtspieltag allen Ernstes eine Familienreise aufzwingen ließ, wurde gekreuzigt. Im Jahr vorm Abi schafften es einer meiner Kollegen und ich für eine Saison in ein Erstliga-Team zu wechseln, danach zog ich nach Deutschland. Heute sind die meisten von uns Mitte dreißig, haben Jobs, vielleicht Familien, mit Sicherheit aber andere Priotitäten. Die Schlägertasche wird aber trotzdem immer noch gepackt.
Tatsächlich waren die späten Neunziger und frühen Nullerjahre in Tschechien für einen derartigen Wahnsinn günstig gewesen. Erstens erlebte Floorball (auch dank der goldenen Eishockey-Jahre) einen massiven Boom. Fast jährlich verdoppelten sich die Zahlen an SpielerInnen und Vereinen. Zweitens zwang die Natur der postsozialistischen, tschechischen Ellbogen-Gesellschaft unsere Eltern dazu, gut fünfzig, sechzig Stunden die Woche durchzuackern. Es war ihnen also ganz recht, wenn sich die Jungs ihre Freizeit mit viel Sport selbst vertrieben.
„Der Junge muss doch auch mal in den Wald“
Es war purer Spieltrieb in Eigenregie. Einmal, mit sechzehn, legten wir spontan unser Erspartes zusammen, mieteten einen Bus an und brachen zu einem Sommerturnier nach Österreich auf. Könnte sein, dass wir dort nicht nur Salat und isotonische Getränke zu uns nahmen, ist klar. Dafür war das Innsbrucker Brauhaus viel zu einladend.
Unser Eifer hatte nicht an irgendeinem überambitionierten Wahn gelegen, auch hatte uns niemand dazu gezwungen. Vielmehr machte es uns unendlichen Spaß, uns mit den besten Freunden zu treffen, einen Verein zu bauen, uns mit immer besseren Gegnern zu messen und gemeinsam diesen kurzweiligen Sport zu betreiben.
In Deutschland schien alles aber irgendwie anders zu laufen, vorsichtiger, zaghafter. Es verblüffte mich, wie wenige Spiele Junioren und Juniorinnen hier absolvierten – oder besser gesagt, bereit waren, zu absolvieren. Irgendeine Handbremse war angezogen. Bitte nicht zu viel davon. So fühlte es sich vor fünfzehn Jahren an als ich nach Berlin zog und oft ist es noch so heute.
Zwar wurde die Woche über fleißig trainiert, Spielpraxis gab es aber kaum. Die ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer rotierten, planten, taten, was nötig war. Bei den wenigen Spielen zogen aber nur ein paar Fleißige konstant mit. Die meisten Spieler waren freie Radikale, die ein anderes, unverbindliches Freizeitangebot vorzogen.
Ein unerwartetes Hindernis waren dabei oft auch die Eltern. Während die einen ihre Kinder unterstützten und sogar selbst anpackten, waren andere überempfindlich und kompliziert. Als ich eine Zeit lang selbst ein Jugendteam betreute, hatte ich damit zu kämpfen, dass „die Wochenenden schwer zu planen“ seien, dass „das Kind doch lernen“, dass man „Verwandte besuchen“ müsse, oder (mein absoluter Liebling) dass „der Junge doch auch mal in den Wald“ soll.

Auch finanziell war man in Tschechien weitaus großzügiger gewesen. Es war völlig üblich 30, 40 oder sogar 50 € im Monat auf den Tisch zu legen, um Hallenmieten, Reisekosten, Material und den Betrieb des Vereins zu decken – und das obwohl tschechische Gehälter bestenfalls einem Drittel der deutschen entsprachen. Hier hingegen wurde geknausert, ob denn ein Mitgliedsbeitrag von monatlich 15 € nicht zu viel ist. Zu viel? Wie können 15 € bitte zu viel für die Gestaltung eines derart umfassenden Freizeitangebots sein? Ich kannte es halt anders.
Meine Freunde und ich hatten damals sehr gute Noten – vermutlich eben weil wir genug Ausgleich hatten, um uns von der Schule nicht genervt zu fühlen. Wir betrieben sogar noch andere Sportarten und übten uns (mit deutlich geringerem Erfolg) an Musikinstrumenten. Planen ließen sich die Wochenenden dank eines Spielplans sehr gut und unsere Eltern hatten genug Zeit für sich. Auch gab es ausreichend (aus der Sicht eines Pubertierenden immer noch zu viele) Tage, Abende oder Urlaubswochen, die man gemeinsam verbringen konnte. Und, obwohl gegen meinen Willen, sogar in den Wald wurde ich oft genug hineingeschleppt.
Von nix kommt nix
Diese mäßige Auslastung deutscher Junioren (und auch Juniorinnen) passte jedenfalls sehr gut zu ihren spielerischen Fertigkeiten. Ihr technisches Können war schon vor fünfzehn Jahren beeindruckend, auch die Fitness war solide – schließlich trainierten sie genug. Das tatsächliche Spiel war aber desaströs. Wie Hühner mit abgehackten Köpfen trotteten sie von Bande zu Bande. Es fehlte an Orientierung, an Automatismen, an Routine, an Dynamik, an grundlegendem Spielverständnis. Als die Spieler in Nachwuchsteams daddelten, waren diese Schwächen noch folgenlos, in der Bundesliga konnte man später aber nur die wenigsten von ihnen einsetzen.
Nun ist Berlin mit Sicherheit immer ein Extremfall gewesen. Die Summe an Ablenkungen war und ist sogar für das Bundesliga-Team eine Herausforderung. Aber auch bei Spielern aus anderen Teilen der Republik war dieses Muster zu erkennen. Technisch mittelmäßige, körperlich unterlegene ausländische Spieler überrollten die deutschen Talente meist ohne Gegenwehr.
Sie wussten viel besser, wie man Maske steht, wo man am besten auf Rebounds wartet, wann man welche Pässe schließt, wie man Gegenspieler ohne zu sperren blockt oder wie man in scharfe Querschüsse die Kelle so hineinhält, dass der Ball unhaltbar ins Netz segelt. Denn zuhause hatten sie gespielt, gespielt und gespielt.
Den meisten Regionen fehlen für einen seriösen Nachwuchs-Wettbewerb auch heute noch schlichtweg die Hallenzeiten. Es ist aber auch ein Problem der Einstellung aller Beteiligten, die oft nicht mehr zu fordern scheinen. Mit „seriös“ ist übrigens das Großfeld gemeint, das ebenso viel zu wenig erzwungen wird. Eine bundesweite U19- oder U21-Juniorliga wäre wichtig, ist unter den aktuellen Bedingungen aber wohl nur Wunschdenken.
Um so ungünstiger ist es, dass Trainings im Nachwuchs zu oft zum Großteil aus Drillübungen bestehen, viel zu wenig aus spielnahen Einheiten. Dass man sich auch noch selbst die besten (also einfachsten, günstigsten und ertragreichsten) Gelegenheiten entgehen lässt, bei Sommerturnieren im nahen Ausland Großfeld-Erfahrungen zu sammeln, ist dann wirklich ein Rätsel. Eigentlich hätten in Prag mindestens zwanzig deutsche Teams gestartet haben müssen. Wo waren alle?
Spielen, spielen, spielen
Gewiss, vielleicht waren meine Freunde und ich eine besonders motivierte Spezies. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man seine Freizeit anders aufteilen möchte. Am Ende liegt der goldene Weg sicherlich irgendwo in der Mitte. Außerdem gibt es mittlerweile auch in Deutschland zahlreiche Vereine, deren Nachwuchs-Teams dem Floorball-Fieber unheilbar unterlegen sind. Auch gibt es in manchen Regionen mehr Programm, anderswo eben weniger.
Mit zehn, zwölf Spielen in der Saison kommt man nicht weit. Dann bleibt’s beim netten Hobby, austauschbar, praktisch für die Regentage. Auch ok. Völlig ok. Wer sich im Floorball aber entwickeln will, muss schon zu seiner Jugendzeit spielen, spielen, spielen. Vielleicht reicht es trotzdem nicht für den großen Durchbruch (im Zweifel gibt es den in unserer Sportart auch gar nicht), aber ohne zu zocken, ohne Bock auf zocken, wird‘s sowieso nichts.
Hinzu kommt, dass wir wohl kaum erwarten können, dass Floorball die Bundesrepublik erobert, wenn wir in unserer eigenen Szene nicht selbst ein bisschen mehr Wahnsinn ins Spiel bringen. Ab und zu Dinge ernster nehmen als sie sind, damit die wirklich ernsten Dinge Konkurrenz bekommen und nicht Überhand gewinnen.
Jedenfalls sollten Vereine, die ihre Jugendarbeit ernst meinen, spätestens im Herbst den Eventkalender 2020 aufschlagen und sich darin alle zugänglichen Nachwuchsturniere markieren, die sich mit etwas gutem Willen umsetzen lassen. Und wenn sie damit durch sind, gründen sie am besten noch ein eigenes.
Foto: Prague Games